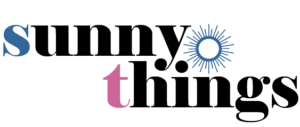Heute ist der zweite freie Tag nach meinem letzten Arbeitstag. Das letzte Mal hatte ich zwei freie Tage am Stück im Januar. Das Wissen, die nächsten Tage auch frei zu sein und nicht zurück zur Arbeit zu müssen, nimmt mir sehr viel Last von den Schultern. Seit Wochen habe ich nicht mehr so viel gelächelt außerhalb der Arbeit. Aber fangen wir am Anfang an.
Da ich im Mai mein letztes Gehalt bekommen habe und seither auf meinen Reisen nicht besonders wenig Geld ausgegeben habe, wurde das Konto zunehmend leerer. Eine Lösung musste her. Über Instagram bin ich auf die Idee gekommen, mich für einen Saisonjob in einem Skigebiet zu bewerben. Ich hatte die romantische Vorstellung, einen Teil der Woche zu arbeiten und den anderen Teil auf der Skipiste zu verbringen. Da sich zum Zeitpunkt meiner Bewerbung die Corona-Situation in Österreich stark verschlechterte, bewarb ich mich in der Schweiz.
Vorbereitung
Von meinen wenigen Bewerbungen erhielt ich eine positive Rückmeldung. Mir wurden direkt zwei verschiedene Positionen angeboten: An der Kasse der Gondel Skitickets verkaufen oder oben auf dem Berg im Selbstbedienungsrestaurant an der Kasse stehen. Gehalt wurde direkt mitgenannt und war aus deutscher Sicht unvorstellbar hoch (Fun Fact: für die Schweiz ist es tatsächlich sogar sehr wenig). Die Entscheidung war schnell getroffen: Ich würde oben auf 1900 Metern mit einer genialen Aussicht im Restaurant an der Kasse stehen. Michael sagte spontan – und ohne je einen Lebenslauf schicken zu müssen – für die andere Position zu.






Die Verträge waren schnell unterzeichnet, uns wurde ein Zimmer zugesagt und so planten wir unsere Anreise für den 26. Dezember. Nach einer langen Fahrt am zweiten Weihnachtstag kamen wir erschöpft, aber auch aufgeregt in Zweisimmen an. Zweisimmen ist einer von mehreren Orten, die zum Skigebiet Gstaad gehören. Ein eher kleines, aber dafür sehr luxuriöses und hochpreisiges Skigebiet. Am Tag vor unserer Abreise hatte sich herausgestellt, dass das versprochene Zimmer nicht existierte oder jedenfalls für uns nicht verfügbar war und wir uns in einem Hotel hier melden sollten. Nachdem man uns fast eine Stunde dort warten gelassen hatte, bekamen wir unser Zimmer. Pluspunkt: Aussicht auf die Skipiste. Minuspunkt: Keine Küche und etwas heruntergekommen. Aber wir hatten ein Bett und am nächsten Tag sollte schon die Arbeit losgehen. Also richteten wir uns so gut es ging ein und gingen schlafen.
Der erste Monat
Der Morgen des ersten Arbeitstages war aufregend. Wir hatten nur minimale Informationen erhalten und wussten nicht, was uns erwartet. Gemeinsam fuhren wir mit dem Auto los. Dort angekommen trennten sich unsere Wege. Michael blieb bei der Kasse, ich traf meine Chefin und meine Kollegin bei der Gondel, um direkt um 8 Uhr morgens hochzufahren. In der Gondel fühlte ich mich einsam und unwohl. Die Leute unterhielten sich auf Italienisch und ich saß stumm dazwischen. Niemand sprach mit mir.
Oben war ich beeindruckt von der Aussicht. Ich konnte es kaum glauben, dass dieser wunderschöne Ort mein Arbeitsplatz sein würde. Das schlug jedes Büro in einer Stadt um Längen. Ganz vorbereitet war man auf meine Einarbeitung nicht, aber in Zusammenarbeit gaben sich meine Kollegen viel Mühe mir den Job nahezubringen. Das Erste, was ich lernte: Covid Zertifikate mussten am Eingang strengstens kontrolliert werden und außerdem putzen, putzen, putzen. Einige Zeit später wurde ich dann auch in die Kasse eingearbeitet und aufgrund hohen Andrangs stand ich dann plötzlich 4 Stunden alleine hinter der Kasse. Ich kam schnell mit den Aufgaben zurecht und hatte bereits nach dem ersten Tag ein grobes Gefühl für meinen Job. Den Rest lernte ich dann in den nächsten Tagen.















Mit jedem Tag tauten meine Kollegen mehr auf, ich wurde integriert und wusste, wie ich meinen Job zu tun hatte. Die Kasse wurde mir vertraut, das Putzen akzeptiert und ich fing an mich wohlzufühlen. Hatte es mich am Anfang noch irritiert, dass wir das komplette Restaurant jeden Tag selbst putzen mussten, so gewöhnte ich mich auch daran und verstand, dass dies bei einem Bergrestaurant eben dazugehört. Trotzdem hätte es bei der Bewerbung erwähnt werden können.
Ich hatte jede Woche zwei Tage frei, meistens sogar am Stück wie ein Wochenende und mehrfach ermöglichte meine Chefin mir die freien Tage sogar gemeinsam mit Michael. Wir gingen Skifahren, ich probierte Snowboarden aus und wir genossen die Zeit auf der Piste. Unsere Wohnsituation belastete mich jedoch zunehmend. Wir hatten keinen Kühlschrank, kochten provisorisch mit einem Gaskocher und der Abwasch fand im Badezimmer statt.
Veränderungen
Irgendwann erhielt ich von einem Kollegen einen Kontakt zu einem Restaurantbesitzer, der auch Mitarbeiterwohnungen vermietete. Diese lagen ein ganzes Stück außerhalb vom Ort, weswegen ich zuerst zögerte. Schließlich fasste ich mir ein Herz und Michael und ich besichtigten die Wohnung. Wir fanden ein schönes Zimmer in einer Wohngemeinschaft vor, das einen Balkon mit Blick auf die Berge und einen Fluss hat und idyllisch in der Natur lag. Ich verliebte mich auf den ersten Blick und auch Michael war überzeugt. Wir würden umziehen und hätten ab sofort eine Küche und würden sogar weniger Miete zahlen.
Nach Wochen hatte ich das Gefühl, wieder richtig atmen zu können. Wir zogen kurzfristig um, sodass ich meine zwei freien Tage im neuen Heim verbringen konnte. So gut hatte ich mich schon länger nicht mehr erholt und frisch ausgeruht ging es zurück zur Arbeit. Mittlerweile hatte ich gelernt, dass ich auch den Job an der Kasse nicht immer machen durfte. Teils waren meine Aufgaben den ganzen Tag lang nur putzen, kontrollieren und abräumen. Glücklich war ich nicht, aber ich arrangierte mich. Es war ja nur ein Job und das Geld gab es trotzdem.









Was mir schwerer fiel, war mich mit meiner Chefin zu arrangieren. Man merkte ihr an, wenn sie gestresst war oder von oben Druck auf sie ausgeübt wurde. Das gab sie dann ungefiltert an uns weiter und stresste uns damit auch. Erklärungen gab es wenige, Anweisungen für unangenehme Aufgaben dafür umso mehr. Nicht selten fühlte ich mich persönlich von ihr ausgesucht und abends nach der Arbeit floss die eine oder andere Träne. Mit ihr zu sprechen, schaffte ich aber aus mangelndem Mut nicht.
Die Hauptsaison
Und dann kam sie – die Hauptsaison. Die Wochen, in denen die verschiedenen Kantone der Schweiz Ferienzeit hatten. Ein Zeitraum von fünf Wochen. Während des ersten Monats waren uns einige Mitarbeiter abgesprungen. Ein weiterer Teil würde während der Hauptsaison nun auf einem anderen Berg arbeiten. Zurück blieb ein verkleinertes Team, das ab jetzt nur noch einen Tag pro Woche freihatte. Die Arbeitslast wurde währenddessen größer. Ich merkte, dass es mir immer schwerer fiel, mich zu entspannen. Der eine freie Tag der Woche sollte sowohl zur Erholung als auch zum Ablenken dienen. Also war immer die Frage: Ausschlafen und entspannen oder früh aufstehen und auf die Piste? Ich probierte beides und weder mit der einen noch der anderen Option fühlte ich mich am nächsten Tag wieder fit für die Arbeit.
So quälte ich mich Tag für Tag, Woche für Woche. Auf der Arbeit wurde ich währenddessen immer vielfältiger eingesetzt. Jemand in der Küche fehlte? Kein Problem, ich wurde kurz in die Essensausgabe eingeschult. Es wurde noch jemand zum Schneeschieben gesucht? Ich durfte helfen. Auf der einen Seite war die Abwechslung in dem sonst eintönigen Job anfangs spannend. Andererseits fühlte ich mich nur noch umhergeschubst und musste jeden Tag mehrere Outfits mitbringen. Es wurde jeden Tag spontan entschieden, wo ich gebraucht wurde. Leider fühlte es sich so an, als erginge es mir als einzige so. Die meisten Mitarbeiter hatten ihre festen Positionen.







Zum Glück gab es auch die Tage, die meine Welt etwas erhellten. An Wochenenden mit gutem Wetter durfte ich draußen das Chalet eröffnen: Ein Holzhäuschen, in dem kalte und heiße Getränke, Süßigkeiten und Hot Dogs verkauft werden. Mein eigener kleiner Bereich mit Schlagermusik, Sonnenschein und Selbstverantwortung. Der Ort, für den ich gerne zur Arbeit gegangen bin. Auch der Tag, an dem die Maskenpflicht aufgehoben wurde, war ein absoluter Lichtblick. Keine Einlasskontrollen mehr, wieder richtig atmen und die Menschen anlächeln. Und nicht zuletzt waren es meine Kollegen, die mich durchhalten ließen. Wir lachten viel gemeinsam, regten uns gemeinsam auf und erzählten aus unserem Leben. Bei so einem Job wächst man sehr schnell zusammen und ist fast wie eine Familie.
Dem Ende entgegen
Zwischendurch kam eine Woche, in der ich plötzlich acht Tage am Stück arbeiten musste, um dann wieder nur einen Tag freizuhaben. Für mich absolutes Neuland und sehr anstrengend, aber jeden Tag ging ich zur Arbeit und machte das beste draus. Das Verhältnis zu meiner Chefin war weiterhin schwankend und ich vermied weitestgehend den Kontakt zu ihr. Und dann kam der neue Dienstplan: Montag bis Sonntag durcharbeiten, kein Tag frei. Dass mein letzter freier Tag der Mittwoch der Woche davor war, spielte keine Rolle. 11 Tage sollte ich durchhalten. Mindestens. Gesetzlich erlaubt? Sicher nicht. In der Gastronomie normal? Vermutlich. Für mich war es die Hölle. Woche für Woche hatte ich mich durch meine 6-Tage-Wochen gequält und war bereits unendlich erschöpft. Und jetzt nicht mal mehr einen Tag frei?






In dieser Woche spielten sich gleich zwei Szenarien an einem Tag ab, die mir vor Augen führten, wie schlecht das Management des Unternehmens ist. Zuerst wurden wir zu einer Mitarbeiterparty am Saisonende von unserer Chefin eingeladen. Direkt darauf schrieb ihre Chefin in die WhatsApp-Gruppe, dass wir uns nicht für die Party anmelden bräuchten, denn wir würden ja arbeiten, um den anderen die Party zu ermöglichen. Kurz darauf fiel das Wasser aus. Kein Tropfen kam mehr aus dem Hahn. In einem Restaurant mit Küche, Abwasch und Toiletten. Der Küchenchef beschloss, die Küche zu schließen. Seine Chefin sah das anders und befahl, weiterhin Nuggets und Pommes zuzubereiten. Das Management stellte den Betrieb des Restaurants über alles andere, über die Mitarbeiter und die Arbeitsbedingungen. Am nächsten Tag sollten wir dann bereits eine Stunde früher kommen, um aufzuräumen.
Das war der Tag, an dem ich beschloss zu kündigen. Der Tag, an dem ich mein persönliches Wohl höher stellte als das Wohl des Restaurants. Gesagt, getan. Am nächsten Tag teilte ich meinen Entschluss meiner Chefin mit. Ihre erste Aussage: Also mehr freie Tage kann ich dir auf jeden Fall nicht geben. Vier weitere Tage sollte ich noch arbeiten. Ich war bereits an Tag sieben. Mein Vertrag hatte eine Kündigungsfrist von drei Tagen. Und so bestand ich darauf, keinen weiteren Tag als diese drei zu arbeiten. An meinem letzten Arbeitstag fuhr ich mit einem Lächeln zur Arbeit. Ich lächelte mich durch den Tag und abends wurde in einer Bar bei Mojitos und Bier die Freiheit gefeiert. Denn ich konnte mir einen Tag zum Durchhängen erlauben. Es war schließlich nicht mehr der einzige freie Tag.
Fazit
Es ist schade, dass ich nicht bis zum Ende durchgehalten habe. Alles in allem ist es trotzdem eine unvergessliche Zeit. Unvergesslich negativ, aber auch unvergesslich positiv. Da ist das Bier mit meinen Kollegen, die Umarmung während der Arbeit, die Insiderwitze. Und dann sind da die vielen Abende unter Tränen. Meine negative Energie, die meine Beziehung auf eine harte Probe gestellt hat. Immer wieder die Frage, ob kündigen mich stark oder schwach machen würde. Ich habe vieles gelernt, ich bin weit über mich hinaus gewachsen und habe an dunklen Orten festgesteckt.
Aber das vielleicht wichtigste, was ich gelernt habe: Es ist meine Entscheidung, was ich mit meinem Leben mache. Ich entscheide, ob ich glücklich sein möchte oder nicht. Und wenn das bedeutet, dass ich auch den dritten, vierten oder fünften Job abbrechen muss, weil er mir meine Lebensenergie raubt, dann ist auch das in Ordnung. Hauptsache, ich entscheide mich. Jetzt genieße ich noch ein paar Wochen an einem der schönsten Orte überhaupt und erinnere mich langsam daran, wie schön das Leben ist. Irgendwann probiere ich dann wieder eine neue Arbeit aus.