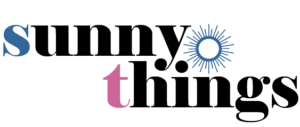1. Wie wenig ich zum Leben und zum Zufrieden sein brauche
Beim Packen war ich wirklich minimalistisch. Obwohl ich mit 45 Litern Fassungsvermögen einen etwas zu großen Rucksack gewählt hatte, habe ich nur das Notwendige einpackt. Das, was ich dabei hatte, hat gereicht. Es war weder zu viel noch zu wenig, ich habe nichts vermisst und alles benötigt. Jeden Nachmittag habe ich meine Wäsche per Hand gewaschen und auf der Wäscheleine in der Sonne trocknen lassen. Nachts habe ich mich in den unterschiedlichsten Räumen mit 4 bis 40 Betten unter meinen Schlafsack gekuschelt und meistens recht gut geschlafen. Meine Trinkflasche habe ich an Brunnen oder unter dem Wasserhahn aufgefüllt und das Essen war oft eintönig (Croissant, Apfel, Tortilla und Huhn mit Pommes), doch mehr habe ich nicht gebraucht.
Fun Fact: Als ich zurückgekommen bin, habe ich erst einmal Schuhe und Klamotten meines eh schon eher beschränkten Bestandes aussortiert. Mir kam es völlig absurd vor, so viele Sachen zu haben – wo ich doch nur so wenig zum Leben brauche.

2. Die Spanier leben fast alle eng beieinander in den Dörfern und Städten
Auf 470 Kilometern zu Fuß durch ein Land bekommt man viel zu sehen – Landschaft, Straßen, Ortseingänge und Ortsausgänge. Lange ist es mir nicht aufgefallen, aber einen Tag machte Dustin, ein US-Amerikaner aus Colorado, mich darauf aufmerksam: Scheinbar gibt es kaum frei stehende Häuser, mit Grundstück und Garten. Außerhalb der Ortschaften waren über Kilometer hinweg keine Häuser zu sehen. Die Landschaft besteht aus Kornfeldern, Maisfeldern, Weinhängen oder Wäldern. Wenn ich dann eine Ortschaft erreichte, reihte sich Haus an Haus, ohne Lücke dazwischen. Sehnen sich die Spanier nicht nach Ruhe oder Abgeschiedenheit? Es ist definitiv spannend, diesen extremen Gegensatz zu Deutschland oder Österreich wahrzunehmen. Vielleicht sieht es im Süden des Landes auch ganz anders aus, wer weiß?

3. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen – jeder!
Ich gebe es ungern zu, schäme mich sogar dafür, aber ich tendiere dazu, Menschen in gewisse Schubladen zu stecken und wenig zu erwarten. Mit meinen vielen Reisen arbeite ich unter anderem auch daran, jedem neutral bis positiv gegenüberzustehen und mich überraschen zu lassen. An einem ganz besonderen Ort, in einer Ruine eines fast 1000 Jahre alten Klosters, war ein Schild über einer Sitzbank angebracht: If you judge people you don’t have the time to love them. Ein wahrer Satz, wie ich finde.
Auf dem Weg ist mir ein weitestgehend vorurteilsfreies Zugehen auf andere Menschen geglückt. Und jedes Mal, wenn ich mich auf jemanden eingelassen habe – wenn ich zugehört und mich wirklich interessiert habe – wurde mir eine spannende, amüsante oder traurige Geschichte erzählt. Oftmals war es sogar etwas, das ich niemals vermutet hätte und das mir eine ganz neue Sicht auf den Menschen ermöglicht hat. Ich hoffe, ich werde diese Einstellung in meinen Alltag übernehmen können. Jeder Mensch hat eine Geschichte und nicht selten überrascht sie dich.

4. Wenn es darauf ankommt, esse ich sogar Linsensuppe
Ich bin kein großer Freund von Linsen und in meinen Kochzutaten kommen sie sicher nicht vor. Nun saß ich aber zweimal in einer Herberge, in der das Abendessen ausschließlich aus Salat und Linsensuppe bestand. Wie jeden Abend war ich hungrig nach der Anstrengung des Tages und wollte meinen Körper mit ausreichend Kraft für die folgende Etappe versorgen. So schob ich das „Ih, das mag ich nicht“ in meinem Kopf einfach beiseite und ließ mir eine ordentliche Portion auffüllen. Und ich stellte fest: Ein bisschen ähnlich wie Erbsensuppe – die esse ich auch, obwohl ich um Erbsen sonst einen großen Bogen mache. Es schmeckte gar nicht so schlecht, wie ich mir ausgemalt hatte. Es würde sicher nie mein Lieblingsessen werden, aber es füllte meinen Magen und mich mit Stolz für das Überwinden meiner Nörgelei.
5. Weder das Internet noch andere Menschen haben immer Recht und es ist allein meine Entscheidung, ob ich mich verunsichern lasse
Dazu habe ich gleich zwei Beispiele. Erstens: Meine Anreise war eine zweitägige Aneinanderreihung von Flügen, Zügen und Bussen und eine gewisse Pünktlichkeit aller Verkehrsmittel war die Voraussetzung für den reibungslosen Ablauf. Das funktionierte bis kurz vor meinem Endziel – Saint-Jean-Pied-de-Port – auch sehr gut. Mit dem Bus fuhr ich von Bilbao in Spanien nach Bayonne in Frankreich, von wo aus ich laut meiner Recherche nur noch den regelmäßig fahrenden Zug nehmen müsste. Als ich mit einer halben Stunde Verspätung Bayonne erreichte, war ich noch tiefenentspannt. Ganz in Ruhe fragte ich das Internet nach der nächsten Zugverbindung. Leider sahen die Ergebnisse nicht halb so vielversprechend aus wie in meiner Erinnerung – ob es am Sonntag lag oder ob ich generell falsch geguckt hatte, wer weiß?
Jedenfalls fuhr laut Internet noch genau ein Zug in etwa 15 Minuten und der wurde als gestrichen angezeigt. Trotzdem ging ich zum Bahnhof, wo der Zug tatsächlich sowohl an der Anzeigetafel als auch auf dem Gleis stand. Kurz vor der Abfahrt hüpfte ich noch hinein. In den Zug, der laut Internet gar nicht fuhr.
Zweitens: An vielen Tagen auf dem Jakobsweg wurde ich von neuen Bekanntschaften gefragt, ob ich denn schon meine Unterkunft für die folgende Nacht reserviert hätte. Ganz zu Beginn reagierte ich mit fragendem Blick. Man konnte Unterkünfte reservieren? Ich war irgendwie der festen Annahme, dass man einfach loslaufen würde und alles Weitere würde sich dann schon ergeben. Immer wieder wurde ich gewarnt, dass ich möglicherweise kein Bett finden würde. Jeder hatte schon von irgendwem gehört, dem das passiert war. In den ersten Tagen ließ ich mich davon noch ziemlich verunsichern und bangte darum, ein Bett zu bekommen. Bis ich lernte, dass ich meist eine der ersten war, die die Herberge erreichten und ich darauf vertraute, dass ich immer eine Lösung finden würde. Bis zum Ende hatte ich niemals auch nur das geringste Problem, einen Schlafplatz zu finden.

6. Alter ist nur eine Zahl
Auf dem Jakobsweg habe ich Menschen von Mitte 20 bis Mitte 70 kennenlernen dürfen. Bunt zusammengemischt haben wir beim Abendessen gesessen, spannende Unterhaltungen geführt und über den Zustand unserer Beine und Füße gesprochen. Wir alle hatten unterwegs unserer Probleme, unabhängig vom Alter – Blasen hier, Schmerzen dort, harte Tage. Irgendwie hat das Alter auf dem Jakobsweg keine Rolle gespielt, wir waren einfach verschiedene Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Zielen und Einstellungen. Doch eins hatten wir gemeinsam: AmMorgen packten wir unsere Rucksäcke und machten uns zu Fuß auf den Weg in Richtung Westen, Tag für Tag.
Direkt in der ersten Woche, angefangen am ersten Abend, baute ich eine enge Bindung zu Daniela und Bernd auf. Das Ehepaar aus Deutschland hat zwei Töchter in meinem Alter und entsprechend groß war der Altersunterschied. Wir verstanden uns super, gingen zusammen, führten tiefgründige Gespräche, machten Selfies und teilten uns Zimmer – und es fühlte sich vollkommen normal an. Denn Alter ist eben einfach nur eine Zahl.

7. Dankbarkeit macht glücklich
Ich glaube, ich war noch nie so oft dankbar, wie auf meinem Weg. Oftmals waren es nur Kleinigkeiten, die in mir diese Dankbarkeit auslösten: eine schöne Dusche, ein richtiges Bettlaken aus Stoff, ein Wasser mit Kohlensäure, ein ausgetauschtes Lächeln oder das Wiedersehen mit einem bekannten Pilger. Auf dem Jakobsweg ist kein Platz für hohe Ansprüche, sodass es viel leichter ist, die kleinen Dinge besonders zu schätzen.
Doch neben der Dankbarkeit für die Momente, die ich unterwegs erleben durfte, fühlte ich das Gleiche in Bezug auf andere Bereiche meines Lebens. Ich spürte die Dankbarkeit für all die gemeinsamen Erlebnisse mit meinem Liebsten, für die liebevolle Aufnahme seiner Familie, für mein Privileg, so viel reisen zu können und auch für meine nicht immer glückliche Vergangenheit, die mich überhaupt erst an diesen Punkt gebracht hat. Obwohl ich versuche, all das immer noch genauso intensiv zu empfinden, fällt es mir außerhalb des Jakobswegs schwieriger. Ich arbeite weiterhin daran.

8. Mein Körper trägt mich durchs Leben und leistet so viel für mich, dass er viel mehr Wertschätzung verdient hat
Wenn ich einige Jahre zurückdenke, kann ich mich an viele sportliche Aktivitäten erinnern, die meine Leben ausgefüllt haben. Angefangen beim Handball spielen. Wie oft bin ich damals umgeknickt und doch jedes Mal mit einer Überdehnung und Zerrung davon gekommen. Beim Cheerleading wurde ich mit schmerzendem Rücken vom Krankenwagen abgeholt und schlussendlich waren es zum Glück nur verkrampfte Muskeln. Bei 50 Kilometer Märschen habe ich mir Blasen geholt, die mein Körper alle mit der Zeit geheilt hat. Ich bin mehrfach einen Halbmarathon mit recht wenig Training gelaufen und mein Körper hat brav mitgemacht. Letztes Jahr kletterte ich spontan auf den Triglav und kam nur mit Muskelkater zurück.
Und jetzt – jetzt bin ich 470 Kilometer durch Spanien gegangen und das war nur dank meines Körpers möglich. Ob er Narben, Falten oder Speckröllchen hat, war dabei vollkommen unerheblich. Das ist eine extrem wichtige Erkenntnis, die jedoch nach der Abreise wieder öfter dem Blick auf meine Kurven gewichen ist.

9. Etwas zu beenden bedeutet nicht aufzugeben
Bei diesem Punkt ist der Lernprozess definitiv noch lange nicht abgeschlossen. Ich glaube, ich versuche mich oft mit den Maßstäben der Gesellschaft zu bewerten. Auf dieser Basis möchte ich dann möglichst richtige Entscheidungen treffen. Als meine Achillessehne anfing zu schmerzen und ich darüber nachdachte, ob ich den Jakobsweg beende, machten mir mehrere Gedanken mein Leben schwer. Zum einen war da der Traum, den ich gerade lebte und von dem ich nicht wollte, dass er schon vorbei ist. Ein Stück weit war auch die Enttäuschung dabei, dieses oft ausgemalte Bild von meiner Ankunft in Santiago nicht erleben zu können.
Und dann war da noch ein dritter Punkt, der mich ärgerte. Ich wollte nicht „schon wieder aufgeben“. Mir fielen all die Situationen ein, in denen ich etwas nicht bis zum Ende durchgezogen hatte. Das Verlassen des Jobs, als es schwierig wurde. Der Versuch, 100 Kilometer zu gehen, den ich bei 63 Kilometern beendet habe. Mein Praktikum letzten Sommer, das ich nach gerade einmal fünf Tagen geschmissen hatte. Und jetzt der Jakobsweg, den ich auch nicht beenden könnte.
Ich würde es als großes Glück bezeichnen, dass ich trotz dieser Zweifel die Entscheidung getroffen habe, meine Gesundheit zu priorisieren. Nein, kein Glück. Selbstvertrauen. Gerade kam mir ein Gedanke, den ich unterwegs noch nicht hatte. Anstatt Verachtung dafür zu spüren, dass ich einiges nicht bis zum Ende mache, sollte ich Stolz empfinden, all diese Dinge überhaupt versucht zu haben. Solange ich weiter herausfinden möchte, was ich vom Leben will, ist dies der einzige Weg. Das macht mich nicht zu einem schlechten Menschen, sondern zu einem neugierigen und entschlossenen!
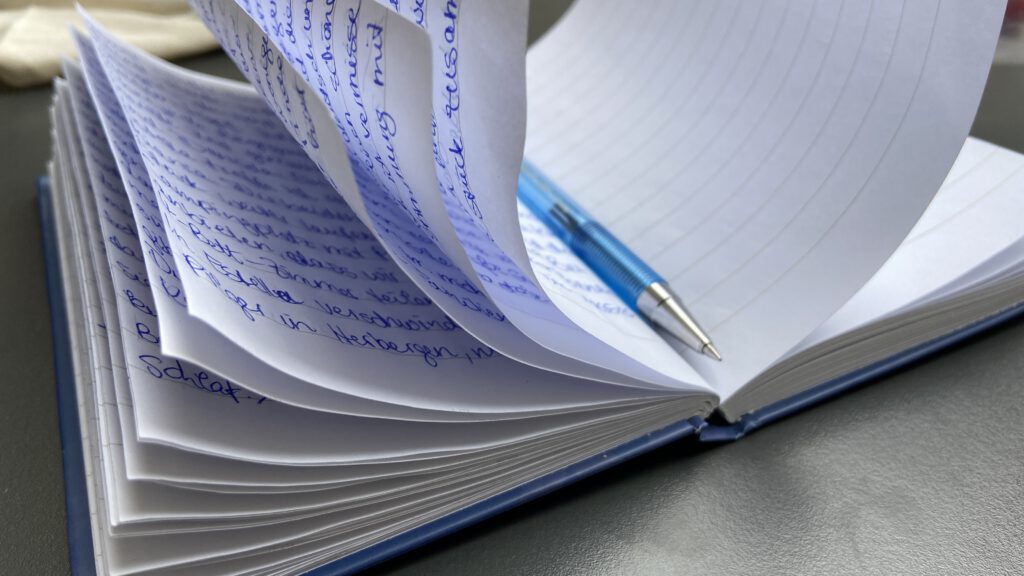
10. Ich liebe Fernwanderungen
Kann man denn auch bei Dingen, die man liebt, ein Tief haben? Ja, definitiv. Nichts im Leben ist nur voller roter Rosen. Doch selbst in diesen Momenten habe ich keine Sekunde an meinem Vorhaben gezweifelt. Das ist mein Ding und das wird nicht das letzte Mal bleiben. Alleine beim Gedanken an all die schönen Momente auf dem Weg läuft mein Herz über.